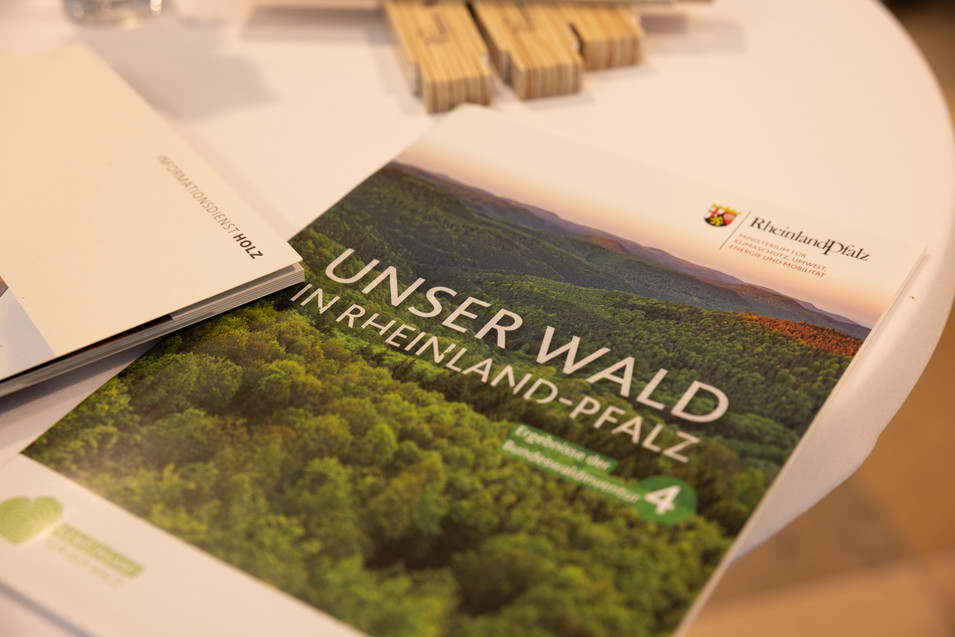Resumée des Forschungsaustausches 2025
Wie gelingt ein effektiver Wissenstransfer im nachhaltigen Bauen mit nachwachsenden und kreislaufeffizienten Rohstoffen? Der diesjährige Forschungsaustausch des „Klimabündnis Bauen in Rheinland-Pfalz – nachwachsende und kreislaufeffiziente Rohstoffe stärken“ brachte rund 75 Teilnehmende aus Wissenschaft, Wirtschaft und Architektur am 30. Juni 2025 in Mainz zusammen, um neue Ansätze für nachhaltiges Bauen zu diskutieren. Im Fokus der Veranstaltung stand der Austausch zwischen Forschung und Praxis: Forschende an Hochschulen, aber auch Fachleute aus der Anwendung sollen stärker miteinander vernetzt und bei der Entwicklung neuer Ansätze unterstützt werden – fachlich ebenso wie im Hinblick auf mögliche Projektförderungen. Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz, das im Rahmen des „Klimabündnis Bauen“ den Wissenstransfer zum Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen koordiniert, konnte in den vergangenen Jahren rund zwei Millionen Euro Fördermittel für entsprechende Forschungsprojekte an Hochschulen bereitstellen.
Der Forschungsaustausch bot gemeinsam mit hochkarätigen Vortragenden von internationalem Renommée einen Ausblick auf das nachhaltige Bauen für Infrastruktur und bei Funktionsgebäuden, insbesondere bei Bestandssanierungen und -aufstockungen, sowie bei der Nutzung von Holz im Außenbereich. Damit wurde auch eine Perspektive aufgezeigt, was jetzt schon für ein klimafreundlicheres Bauen möglich ist.
Gelungener Auftakt: Exkursion zum Timber Peak in Mainz
© Sven Hasselbach

Schon vor Beginn des offiziellen Programms erhielten Interessierte bei einer Baustellenbegehung durch das Hochhausprojekt „Timber Peak“ einen Einblick in die Anwendung moderner Holzbauweisen im urbanen Maßstab. Das Hochhaus entsteht aktuell in Mainz als erstes seiner Art in Rheinland-Pfalz in Holzhybridbauweise. Die Teilnehmenden zeigten sich beeindruckt von den Details und der Schnelligkeit des Bauablaufs. Die Firma UBM zeigte anschaulich, wie sich ein klimafreundliches Gebäude durch gute Planung und enge Abstimmung aller Abläufe realisieren lässt. Eine durchdachte Rohbau- und Holzplanung, präzise Vorfertigung und eine abgestimmte Logistik machen es möglich, die Potenziale der Holzhybridbauweise voll auszuschöpfen. So kann beispielsweise innerhalb einer Woche der Rohbau eines kompletten Geschosses montiert werden.
Eröffnung und Einführung
© Sven Hasselbach

Das offizielle Programm begann im Kalkhof-Rose Saal, ein Gebäude das mit dem Holzbaupreis Rheinland-Pfalz 2024 in der Kategorie „Bauen im Bestand“ ausgezeichnet wurde. Durch die Veranstaltung führte Dr. Andreas Nikolaus Kleinschmit von Lengefeld, der sich auf europäischer Ebene seit vielen Jahren in verschiedenen Fachgremien für das Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen engagiert. Er gab einen Blick auf die Chancen und Herausforderungen dieser Bauweise – insbesondere aus internationaler Perspektive. Der Generalsekretär, Prof. Dr. Claudius Geisler heißte als Hausherr die Anwesenden herzlich willkommen, und zeigte sich begeistert vom Ergebnis des Bauwerks in Holz.
© Sven Hasselbach

Ein Schwerpunkt des Programms lag auf der Akustik des neuen Kammermusiksaals, der als deutschlandweit erster Saal in Holzbauweise als Aufstockung des bestehenden Akademie-Ensembles realisiert wurde. Architekt Timm Helbach (MAMUTH Architekten) und Soundingenieur Jochen Veith (Audio- und Acoustic Consulting) gaben im ersten Vortrag der Veranstaltung Einblicke in das komplexe Zusammenspiel von Materialwahl, Raumgeometrie und akustischer Planung.
Die Herausforderung der Aufstockung: Durch das geringe Eigengewicht des Bestandsgebäudes kam es zu ungewollten Schwingungen, und so zu einer unsauberen Akustik. Der Architekt und der Soundingenieur erläuterten gemeinsam, wie die speziellen Anforderungen umgesetzt wurden um ein einwandfreies Klangerlebnis zu realisieren. Sie gaben einen Einblick in die physikalischen und technischen Grundlagen akustischer Anforderungen an Konzerträume und sprachen über Strategien der baulichen Umsetzung im Holzbau. Dabei ging es unter anderem um das Konzipieren von mehrschaligen Wandaufbauten und schalltechnische Entkopplungen in Holzbauten mit erhöhten schallschutztechnischen Anforderungen.
Um die Akustik des Saals eindrücklich unter Beweis zu stellen, spielte die Pianistin Jennifer Klein mehrere Stücke, die die Klangwelt und die Bandbreite von Musik exzellent darstellte. Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich beeindruckt von der Spielkunst, aber auch von dem akutischen Volumen, den der doch eher kleine Saal wiedergab.
© Sven Hasselbach

Der nächste Vortrag war ein thematischer Sprung in die Grundlagenforschung der Materialanwendung: „Baustoffe weiterdenken“ – wie lassen sich bekannte Eigenschaften von Materialien so verändern, dass sie langlebiger und daher nachhaltiger eingesetzt werden können?
Dieser Frage geht das Team des „t-lab, Holzarchitektur und Holzwerkstoffe“ an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau seit 2014 nach. Unter anderem wird daran geforscht, wie Laubholz, das normalerweise nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist, durch unbedenkliche chemische Veränderungen, wie etwa Acetylierung, nutzbar gemacht werden kann.
Holztragwerke im Außenbereich (z.B. Brücken, Türme, Balkone, etc.) sind einer direkten Bewitterung ausgesetzt. Traditionelle Holzschutzstrategien, wie der Einsatz dauerhaftere Holzarten (Eiche, Edelkastanie, Lärche), bauliche Maßnahmen (Bekleidungen, Abdeckungen, Hinterlüftungen) und chemische Maßnahmen werden seit einigen Jahren durch Holzmodifikationen ergänzt.
Acetylierte Hölzer – eine Variante der chemischen Modifizierung – sind bereits seit Jahren erprobt und etabliert, etwa aus Kiefernholz (Anbaugebiete: Chile, Neuseeland). Hochtragfähige Hölzer aus der heimischen Buche werden als Furnierschichtholz seit Langem im Innenbereich eingesetzt, beispielsweise in Hallentragwerken. Die Forschung am t-lab, in Kooperation mit der Universität Göttingen und den Industriepartnern Accsys (chemische Modifizierung) und Dehonit (Herstellung der acetylierten Furnierschichthölzer), verbindet nun beide Ansätze: Es entsteht ein neuartiger, hochfester Holzwerkstoff aus heimischem Buchenholz. Dessen Eigenschaften – hohe Formstabilität, Dauerhaftigkeit (vergleichbar mit Teak), Tragfähigkeit und vollständige Rückbaubarkeit – sollen im Reallabor auf der Landesgartenschau in Neustadt/Wstr. erstmals erprobt werden.
Mit dem Werkstoff „acetyliertes Buchenfurnierschichtholz“ werden die bestehenden Einsatzmöglichkeiten von Holz für größere Tragstrukturen im bewitterten Außenbereich erweitert. Dipl.-Ing. Reiner Klopfer gab einen Ausblick darauf, was die Grundlagenforschung künftig für die praktische Anwendung leisten kann.
© Sven Hasselbach

Wie kann Infrastruktur klimafreundlich gedacht und gebaut werden? Dieser Frage widmete sich das Ingenieurbüro Miebach mit dem dritten Vortrag der Veranstaltung.
Denn Infrastrukturprojekte gehören heute zu den größten Verursachern von CO2-Emissionen und Deponieabfällen. Vor allem beim Rückbau von Straßen und Brücken entstehen große Mengen an Bauschutt und Stahlbetonresten, die nur mit erheblichem Aufwand getrennt und recycelt werden können.
Infrastrukturbauten wie Brücken und Türme zu konstruieren, die eine hohe CO2 Speicherfähigkeit (und einen geringen Anteil an Beton) aufweisen, ist das erklärte Ziel vom Ingenieur-Büro Miebach. Man hat dort bereits vor mehr als 20 Jahren begonnen, nachhaltige Konstruktionen aus Holz für Autobahnüberquerungen, Radbrücken und touristische Infrastruktur wie Aussichtstürme zu entwickeln. Ein herausragendes Beispiel ist die Fußgängerbrücke über den Pariser Autobahnring A1 – eine über 100 m lange, klimafreundliche Holzbrücke über eine der meistbefahrenen Autobahnstrecken Europas.
Moritz Duffhauß, Holzingenieur im IB Miebach, zeigte in seinem Vortrag auf, wie herkömmliche Materialien durch Holz und andere innovative Baustoffe ersetzt werden können – unter Einsatz einfacher, durchdachter Konstruktionen und mit Freude am ingenieurtechnischen Gestalten.
Exemplarisch dafür wurden einige Brücken im europäischen Ausland gezeigt und beschrieben, hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf die Konstruktion und den konstruktiven Holzschutz gelegt. Auch der Idarkopfturm in Rheinland-Pfalz wurde vorgestellt.
© Sven Hasselbach

„Ein fast unmögliches Haus“ – Architekt Christian Taufenbach von Element A Architekten erläuterte am Beispiel der DAV Geschäftsstelle eindrücklich wie integrale und gewerkeübergreifende Planung bei der Sanierung von Bestandsgebäuden ist. Einerseits trägt sie dazu bei, ein architektonisch höchst ansprechendes und baukulturell sensibles Ergebnis zu erhalten. Andererseits ist sie gerade bei Fragen zu konstruktiven Einbauten und technischen Anforderungen, wie Deckenhöhen, Brandschutz und Haustechnik – Stichwort Lowtech – entscheidend, um ein gutes Mittelmaß für die Nutzerinnen und Nutzer sicherzustellen.
Element A Architekten ist es so gelungen, eine Sanierung zu realisieren, die letztendlich nur einen Bruchteil eines Neubaus kostete. Taufenbach zeigte außerdem, wie Holzeinbauten in diesem Projekt dazu beigetragen haben, dass sich das Brandschutzkonzept trotz Gebäudeklasse 5 einfach umsetzen ließ. Ein gutes Vorbild für viele Planerinnen und Planer, denn das Bauen im Bestand, und das Finden von pragmatischen Lösungen ist die Hauptbauaufgabe in der Architektur des 21. Jahrhunderts.
In seinem Vortrag gab Taufenbach einen umfassenden Einblick in die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteurinnen und Akteure und legte dabei das Augenmerk auf die zentrale Rolle der Architektenschaft beim Thema „Bauen in Bestand“ aber auch zum Thema Serielles Sanieren von Bestandsgebäuden mit Holzbauteilen.
An das offizielle Vortragsprogramm anschließend wurde der Forschungsaustausch mit dem Ideenmarktplatz und einem After-Work-Dialog an den verschiedenen Stationen abgeschlossen. Diverse Lehrgebiete der Fachhochschulen und Universitäten zeigten aktuelle, innovative Forschungsprojekte, die oftmals einen sehr starken Praxisbezug aufweisen.
Der Forschungsaustausch fand insgesamt große Resonanz der rheinland-pfälzischen Forschenden. Der Ideenmarktplatz ermöglichte einen vertieften Dialog zwischen Forschung und Praxis und bot Raum für neue Kooperationsansätze. Der Kammermusiksaal bot mit seiner besonderen architektonischen und akustischen Qualität einen passenden Rahmen für die Veranstaltung.